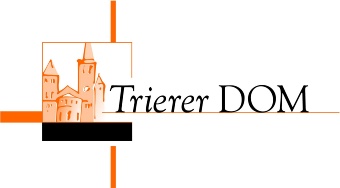Der imaginäre Vorhang ist geöffnet. Die Betrachtenden haben einen freien Blick auf das zentrale Geschehen des göttlichen Dramas.
Was die Betrachtenden erkennen, entspricht nicht ganz dem, was im Weihnachtsevangelium verkündet wird: „Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt“ (Lk 2,12).
Keine Krippe, kein Futtertrog, keine Liegefläche aus Stroh ist zu sehen. Und das neugeborene Kind trägt auch keine Windeln. Was wir sehen, ist eine Frau, eine Mutter, die nicht mehr von der Geburt geschwächt scheint, sondern fast entspannt ihren Sohn auf dem Schoß hält. Und das Kind – auch schon etwas kräftiger - liegt da völlig nackt.
Wir sind verwundert über diesen Anblick. Welche Mutter würde ihr Kind in dieser Weise präsentieren, und dann noch „wildfremden“ Menschen? Würde sie nicht eher seine Blöße bedecken, weniger aus Scham, als vielmehr zum Schutz. Die Würde dieses neugeborene Kind gilt es zu schützen, wie die Würde eines jeden Kindes oder eines jeden anderen Menschen auch.
Wir merken es: Die Dom-Krippe „löst“ sich hier von der Erzählung des Lukasevangeliums und geht schon mehr zur Deutung über. Vielleicht denken wir an eines der ältesten Zeugnisse im Neuen Testament, das uns im Philipperbrief vorliegt: „Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen“ (Phil 2, 6-7).